Designer, Ott+Stein
Was hat Ihr persönliches Interesse an der Gestaltung und am Design in besonderem Maße geweckt?
Nicolaus Ott: Da müssen wir weit zurück. Ich war zwölf Jahre alt. Mein Onkel war Grafiker, damals hieß es noch Gebrauchsgrafik. Ich habe nach der Schulzeit bei ihm eine klassische Lehre gemacht. Mit zwölf Jahren bin ich immer zu ihm ins Atelier gegangen. Er hat zu dieser Zeit viele Filmplakate entworfen und ich fand es faszinierend, wie auf weißem Karton nach zwei Tagen Motiv und Schrift entstanden. Ich fand das sehr beeindruckend und hatte dadurch Lust, so etwas später einmal zu machen. Das war der Anfang meiner Neugierde, die bis heute geblieben ist.
Bernard Stein: Ich habe 2002 aus dieser Frage heraus für MetaDesign eine Ausstellung gemacht, bei der ich 40 Gestalter (mich inklusive) gebeten habe, die drei jeweils ersten Sachen zu benennen, die sie zur Gestaltung gebracht haben. Bei mir war es ein Buchumschlag von Christian Chruxins „Das Waisenhaus.“ Er hatte Bauklötzchen genommen, und diese auf einer weißen Fläche ungeordnet hingelegt und auf der Vorderseite entstand aus ihnen ein Haus mit einem Schornstein, aus dem gleiche Formen ausgestoßen wurden. Ich war damals 16 und mir hat gefallen, mit wie wenig man eine komplexe Idee darstellen kann. Das zweite Beispiel lag auf meinem Schulweg. An einem Kiosk auf dem U-Bahnhof Hermannplatz gab es die polnische Kulturzeitschrift „POLEN“, die ich mir immer dort gekauft habe. Den Inhalt habe ich zwar selten gelesen und noch seltener verstanden, aber die Cover von Lenica, Swierzy, Cieslewicz und anderen waren großartig. Und mein drittes Beispiel ist das Lied „For What its Worth“ von Buffalo Springfield – großartige Musik und hochkomplexer Inhalt.

Da Sie das Thema gerade ansprechen, was bedeutet Gestaltung für Sie? Wo ist Ihre Differenzierung zwischen Gestaltung und Kunst?
Ott: Der große Unterschied ist, dass man bei angewandter Gestaltung das Thema gestellt bekommt. Man kriegt einen Auftrag und den versucht man umzusetzen. Bei der Kunst muss alles aus einem selbst herauskommen. Das ist schon ein gravierender Unterschied.
Stein: In der Beauftragung und der Autorenschaft.
Ott: Ja genau, beim Künstler ist man selbst Autor und beim Grafiker wird einem das Thema geliefert und man versucht es auf eigene Sichten zu interpretieren.
Also letzten Endes wird die eigene Entfaltungsmöglichkeit dadurch auch eingeschränkt?
Ott: Das liegt dann an einem selbst, wie man mit der Gestaltung umgeht, dass man Sachen entwirft, die man zuvor nicht so kannte. Das ist ein Prozess, der entsteht und was nachher herauskommt, wissen beide nicht – der Auftraggeber weiß es nicht und als Gestalter weiß man das auch nicht.
Stein: Für mich ist Gestaltung eine extreme Erfolgsgeschichte. In der Zeit, als Nico und ich angefangen haben (1. Januar 1978 Anm. d. Red.), war das Wort Typografie den meisten Leuten nicht bekannt, und bei der Gestaltung ging es vor allem darum, „gestalten zu können“ – das musste man können. Heute gestaltet in unseren Gesellschaften fast jeder und die Frage ist nicht: „Was ist verloren gegangen?“, sondern: „Was ist das Wesen von Gestaltung?“. Für mich liegt das Wesen von Gestaltung darin, Gemeinschaften zu bilden. Das sehen Sie historisch an den Kirchen und dem Militär und später an Firmen und Institutionen. Heute gilt es für uns alle, gestalterisch die Gemeinschaften zu bilden, in denen wir uns wohl fühlen. Hier liegt auch der Unterschied zur Kunst. Während Gestaltung Gemeinschaften bildet, stabilisiert die Kunst das Individuum, wenn man von dem ganzen Kunstmarktgedöns mal absieht.

Was macht gute Gestaltung aus? Wo ist denn dann noch das Besondere, wenn es jeder machen kann?
Ott: Gute Gestaltung, finde ich, ist nach wie vor: Man muss mit sich authentisch sein. Wenn man das nicht ist, dann weiß man doch gar nicht, was gute Gestaltung ist. Ich finde, wenn man seine Emotionen, sein Inneres nach außen kehrt und das Gefühl hat, zu machen, was einem selbst entspricht, dann kann das nicht verkehrt sein. Insofern ist gute Gestaltung relativ. Die eigene Sicht auf die Sache deutlich machen und, wenn die in sich eine Stimmigkeit hat, dann kommt das auch für den Betrachter. Das wäre für mich gute Gestaltung. Man kann es nicht so dogmatisch sehen.
Aber gleichzeitig gibt es ja Epochen in denen gewisse Formensprachen häufiger benutzt wurden als andere.
Ott: Das ist ja kein Widerspruch.
Also diese Selbstentfaltung und das Nach-außen-Kehren der eigenen Ästhetik, die man für richtig hält, hängt ja auch damit zusammen, was gerade z. B. als modern bezeichnet wird.
Ott: Man ist immer Kind seiner Zeit, das ist schon richtig. Man ist irgendwie auch Kopist. Man sieht viele Dinge, vereinnahmt sie, und dann entsteht etwas Eigenes aus einem selbst. Man ist schon auch darauf angewiesen, die Umwelt wahrzunehmen und sie zu interpretieren.
Stein: Zum einen ist es gut, in der Zeit zu sein, um wahrgenommen zu werden. Aber man kann auch mittels der Gestaltung zeigen, dass sich Zeiten gerade ändern – da gibt es dann eine „neue“ Raum- und Formsprache. Wir haben 1983 eine Plakatserie für Berliner Museen gestaltet. Große schwarze Flächen mit minimal kleinen Abbildungen der jeweiligen „Kunstschätze“: der Nofretete, eines Südseeboots oder eines 6m-breiten Barnett Newman. Es ging uns darum, zu zeigen, dass alle Objekte eine Aura haben, und diese macht ihr Wesen aus. Die Zeit war aber gerade noch darin, alles bis ins letzte Detail zu erklären – mit viel Text und sezierender Sachfotografie. Unsere Plakate waren wie ein Preview.
Ott: Jaja, ich finde auch schon, so eine kompositorische Stärke, die hat man oder nicht. Wo man Sachen in Beziehung setzt, ob das jetzt Typografie ist, ein Bild oder die Größe zueinander. Da gibt es eigentlich auch keine Richtlinien. Es ist auch ein bisschen Gespür, zu sehen, ob das in sich eine Stimmigkeit hat, kompositorisch gut gemacht ist oder auseinanderfällt. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die aber eine große Auswirkung haben. Als wir analog gearbeitet haben, entwarfen wir unsere Plakatentwürfe im Maßstab 1:1. In dieser Größe ist die Gewichtung der Komposition besser.

Worin liegt für Sie der ganz besondere Wert: visuelle Gestaltung zu schöpfen?
Stein: In der Qualität und dem Bewusstsein davon. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass man Gestaltung bereits in der Schule unterrichtet, sowohl was die Bildung von Gemeinschaften betrifft, als auch, um sich bewusst zu werden, dass wir ständig gestalten.
Ott: Es kommt noch etwas hinzu. Wenn man jetzt beim Gestalten vom Visuellen ausgeht, war es für mich schon reizvoll und spannend, komplexe Dinge so stark zu reduzieren, dass sie dennoch glaubhaft vermittelt werden können. Das Reduktive empfand ich in der Gestaltung immer als Ansporn, Dinge und Themen erklärbar zu machen. Wenn sie nicht erklärbar sind, müssen gestalterische Visualisierungen entstehen, die beim Betrachter Neugierde zur Interpretation erwecken.
Aber geht denn nicht mit der Reduktion weniger Glaubwürdigkeit einher?
Ott: Auch das kann man nicht pauschalisieren. Mal ist es ganz gut zu reduzieren, mal ist es Überfluss. Insofern ist das Schöne in der Gestaltung, nichts ableiten zu können. Ich fand es auch in der Lehre ganz wichtig, den Student*innen zu sagen: „Ihr müsst euch viel ansehen und viel informieren“. Wenn man ein Thema bearbeitet und sich Vorlagen anschaut, um zu sehen: Wie haben andere das gelöst? – dann hat man schon verloren. Man muss versuchen, in sich zu gehen und das Thema zu seiner eigenen Sache machen. Dann wird die Gestaltung zur eigenen individuellen, glaubhaften Lösung. Das ist eine wichtige Erkenntnis: aus sich selbst zu schöpfen.
Stein: Nico macht ja seit einiger Zeit schon Arbeiten, die sind am Übergang von Gestaltung zur Kunst. Und die haben genau dieses Maß an Reduktion. Es sind Typobilder – dabei nimmt er ein Wort oder einen Namen, den er so reduziert, dass er ihn schlüssig visualisiert. Das kann man nicht mehr gemeinsam machen. Da geht sein gestalterischer Input über in einen künstlerischen Ausdruck, der nur ihn betrifft. Die Emotionen bleiben immer die künstlerische Aussage.
Ott: Also, der Vorteil unserer Gemeinsamkeit war natürlich, dass, wenn wir uns in der Gestaltung einig waren, auch sehr entspannt präsentieren konnten. Wir haben immer nur einen Entwurf gezeigt. Wir haben zwar im Atelier viele entworfen, aber sagten uns: „Wir sind die Profis, wir müssen die Priorität vorgeben, was wir gut finden.“
Stein: Wir waren auch extrem genau in unserer Arbeit, weil sie durch uns beide gegangen ist. Dieser Prozess hat dann dazu geführt, dass wir beide dazu sagen konnten: „Ja, so ist es“. Und da fällt es dann, wenn wir nicht einen absoluten Denkfehler gemacht haben, natürlich auch dem Auftraggeber nicht schwer zu sagen: „Ja, dann machen wir das doch so!“
Ott: Das reine Machen war einfach wunderbar.
Stein: Alles, vom Entwurf,über die Gestaltung, bis zur Herstellungsvorbereitung, gemeinsam zu machen istwas anderes, als nur mit dem Gegenüber eines Bildschirms zu tun zu haben.
Ott: Ich habe viele Entwürfe handwerklich getätigt und hatte Schwierigkeiten mit den neuen digitalen Geräten. Das war dann für die Lehre wieder gut. Die Student*innen konnten sehr viel schneller und besser als ich die Computer bedienen, ich konnte mich intensiver auf den Inhalt konzentrieren. Es war schon irgendwie hart... auf einmal war irgendwie die alte Könnerschaft nicht mehr gefragt.
Stein: … und der Dialog, bei dem man sich in die Augen blickt.
Ott: … und der Dialog. Und dann ging gar nichts mehr. Das war dann auch der Grund, weshalb wir sagten, dass das Gestalten nicht mehr gemeinsam geht. Aber es waren immerhin 24 Jahre, jeden Tag.
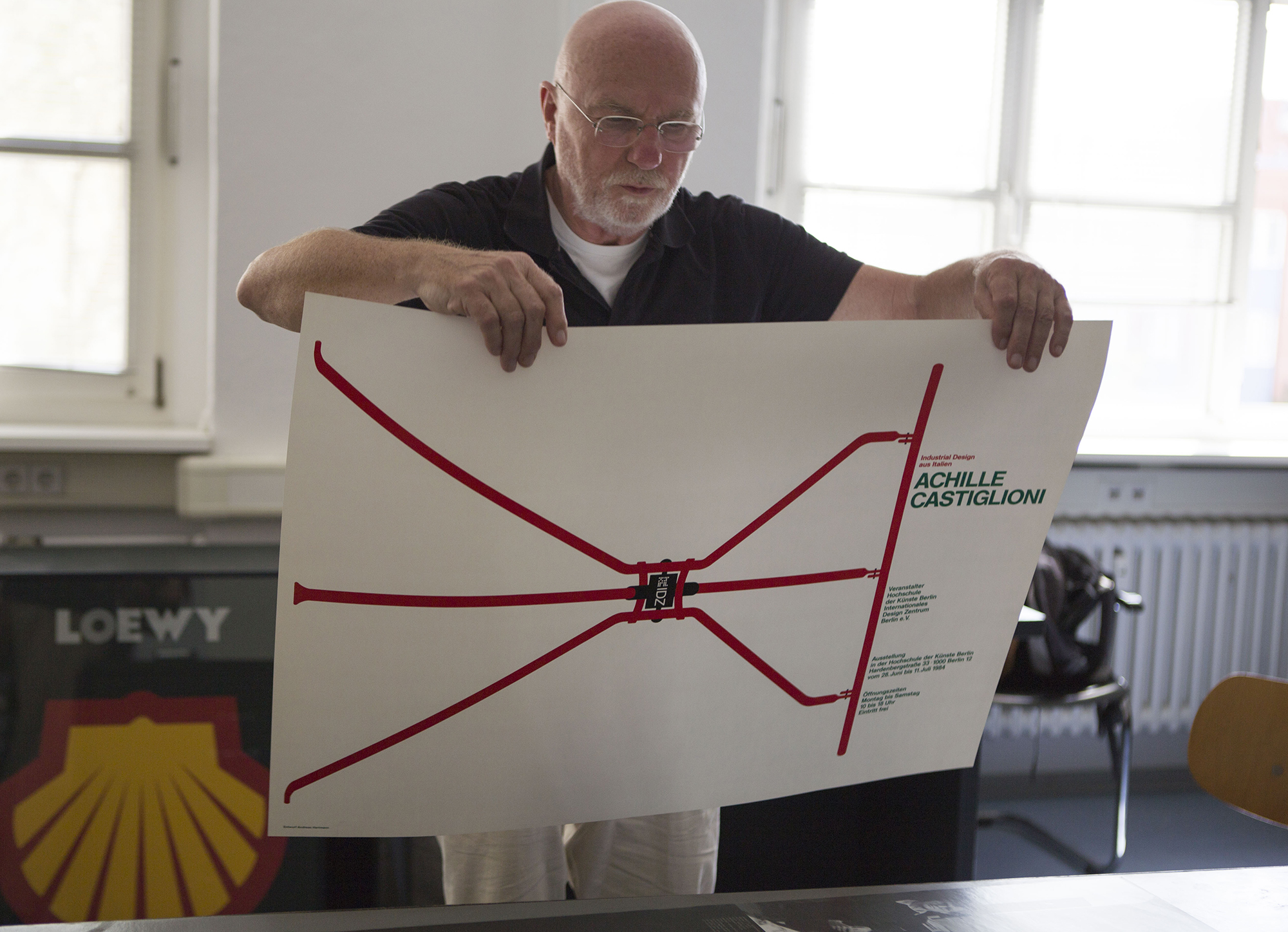
Eine Frage, die eigentlich schon sehr in diese Richtung geht: Welchen Mehrwert hat denn überhaupt diese intensive Zusammenarbeit, die Sie ja über Jahrzehnte gepflegt haben? Über diesen dauerhaften Dialog hinaus. Man tauscht sich natürlich darüber aus, was aus einem herauskommt.
Ott: Die Basis war, glaube ich, dass man sich gegenseitig auch als Mensch gerne mochte. So kamen wir zu dem Endschluss, die Gestaltung auch gemeinsam zu machen. Wir sind sehr unterschiedlich, was wir am Anfang gar nicht so gemerkt haben. Aber im Laufe der Zeit war es gut, diese Gegensätzlichkeiten immer mit diesem Dialogischen zu verbinden. Wir haben uns immer sehr „gefetzt“. Wir haben eine hohe Streitkultur entwickelt. Diese Streitkultur war immer persönlich, aber letztendlich ging es um die Arbeit. Da war man Gott sei Dank sehr großzügig. Diese Gegensätzlichkeit lief bei uns beiden in die Arbeit hinein, und das war wunderbar.
Wie äußert sich das dann in der Arbeit, wenn Design doch undemokratisch ist, weil es prinzipiell nicht zulässt, alle Meinungen gleichwertig in eine Lösung zu integrieren? Wie sind Sie damit umgegangen?
Stein: Ich bin da überhaupt nicht der Meinung – es ist ein Prozess des gegenseitigen Mitnehmens. Das, was am Anfang des Prozesses undemokratisch erscheinen könnte, sollte im Idealfall am Ende des Prozesses gemeinschaftlich sein.
Ott: Da bin ich auch nicht der Meinung.
Am Ende braucht es ja dann für so eine gestalterische Zusammenarbeit, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, auch einen bestimmten Charaktertypus.
Stein: In der Zusammenarbeit ist die ganze Persönlichkeit des jeweils anderenentscheidend. Sie garantiert ein Höchstmaß an Qualität. Dazu kommt natürlichder an seiner Sache nicht nur finanziell interessierte Auftraggeber. Aber inder Bearbeitung des Auftrags ist die Meinung des jeweils anderen maßgeblich. Damusste man von sich selber ein Stück auflösen, zu Gunsten des Ott+Stein.


Wir hatten vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen: der Verlust der handwerklichen Fähigkeiten durch diese digital unterstütze Gestaltung. Was glauben Sie, was in Zukunft an Möglichkeiten noch passieren kann. Ich denke zum Beispiel daran, dass sich visuelle Geschmäcker durch Algorithmen herauskristallisieren und es gar nicht mehr den klassischen Gestalter gibt, sondern durch den Computer letzten Endes ein Bild entworfen wird, das dann von allen als schön empfunden wird.
Stein: So eine Art Mehrheitsbild?
Ott: Aber, ich meine, der Reiz ist ja, dass man eigentlich auchdagegenhält. Ich meine, da kommt das Individuelle ganz stark durch. Man wird perfekte Gestaltungen hinbekommen, dieunheimlich ansprechend, auf einem hohen Level liegen,aber der Reiz, aus seiner Sicht dagegen zu halten und dasindividuell umzusetzen, wird stärker sein. Insofern habe ich überhauptkein Problem damit, was in Zukunft passiert.
Also keine Angst diesbezüglich?
Stein: Nein, ganz im Gegenteil. Im Augenblick sind wir natürlich noch in einer ganz frühen Phase visueller Gestaltung. Uns fehlen noch jede Menge qualitativer Kriterien, aber daran mitzuwirken lohnt sich.
Ott: Also, der beste Bestandteil ist, dass sich die Dinge immer verändern. Irgendwann ist eine Sättigung da, dann beginnt was Neues. Das ist wunderbar. Dadurch entsteht Zukunft. Nicht, dass was aufhört, man kann das auch dialektisch sehen. Es animiert ja, dagegen anzugestalten. Ich sehe eigentlich keine Gefahr, dass die guten Sachen verschwinden. Es gibt Zeiten, die gestalterisch stärker und Zeiten, die gestalterisch schwächer sind. Keine Sache hat Bestand. Spannungen sind notwendig, sonst passiert nichts.
Würden Sie sagen, dass die Rolle des IDZ in Zukunft noch wichtiger werden wird, um einen Austausch zu erhalten?
Stein: Der persönliche Austausch ist für mich die zentrale Aufgabe des IDZ. So war es und wird es hoffentlich auch bleiben.
Ott: Dieses persönliche Treffen und Austauschen über die Arbeit ist immer notwendig. Das kann die digitale Welt nicht leisten, das müssen dann Orte sein, an denen man sich wirklich gegenübersitzt. Die Nuancierung ist eine ganz andere, wenn man persönlich etwas austauscht, da entstehen Feinheiten und man entwickelt eine höhere Akzeptanz gegenüber anderen Personen.
